
Trauern im Krieg
von Horst Schreiber
Im März 1945 fiel der Vater bei Danzig. Die Mutter und Oma luden gerade Mist auf, als die Nachricht eintraf. Franz-Josef Witting aus Zirl fühlte sich noch als alter Mann unsäglich traurig, wenn er sich an diese Szene erinnerte: „Dieser Ausbruch von Leid, die Schreie des Elends der beiden Frauen! Niemals mehr habe ich so Schreckliches erlebt.“
Heldenbücher – Heldengedenken
Die Partei organisierte mit den Bürgermeistern das Gedenken an die toten Soldaten. In Stams legte der Bürgermeister ein aufwendig gestaltetes Heldenbuch an. Alle Männer der Gemeinde, die in den Krieg zogen, nahm er auf: mit Foto, Dienstgrad, Einsatzort, Auszeichnungen – und mit ihrem Heldentod. Als er selbst einrücken musste, war es mit dem Heldenbuch vorbei. Niemand wollte es mehr weiterführen. Ortsgruppenleiter und Gemeinde hielten beim Kriegerdenkmal und am Dorfplatz Heldengedenkfeiern ab, die Musikkapelle spielte, die Schützen marschierten auf. Die Trauerreden der Parteigenossen ertranken in kitschigen Metaphern, immer war der Tod des Gefallenen verbunden mit dem Aufruf zu weiterer Opfer- und Einsatzbereitschaft für Hitler, für Deutschland, für die Volksgemeinschaft, für die Verteidigung der Heimat vor den westlichen Luftterroristen und der Bestie im Osten, für den in immer weitere Ferne rückenden Endsieg. Das ideologische Gestammel wirkte mit der steil ansteigenden Zahl an Toten abgedroschen, lächerlich, grotesk. Dennoch war vielen die Ehrung des Gefallenen, der musikalische Rahmen und das Antreten der Traditionsverbände wichtig, manchen ein Trost. Nicht nur den überzeugten Nazis.

Sterben für den Sieg und Großdeutschlands Zukunft
Die Vorgesetzten eines Gefallenen benachrichtigten die Familien in der Heimat mit vorgefertigten Floskeln, nationalistischen Phrasen und hitlerischem Geschwurbel. Anton Pinzger war Bauer, ihn schmerzten die Zerstörungen in den besetzten Gebieten. Er schrieb seinen Eltern nach Fiss, wie es nahe der lettischen Stadt Bauska nach dem Abzug der Wehrmacht aussah: die Ernte vernichtet, die Häuser zertrümmert, die Einwohner geflüchtet, moderne Einrichtungen durch Brandstiftung und Artillerie zerstört, das Vieh totgeschossen. Pinzger starb in den frühen Morgenstunden des 19. August 1944 durch Granatsplitter. Die Truppe musste ihre Stellungen in aller Eile räumen. Sie konnte seinen Leichnam nicht mehr bergen. Er verweste an unbekanntem Ort, verscharrt vom Feind. „Möge Ihnen in dieser schweren Stunde die Erkenntnis, dass Ihr lieber Anton für Grossdeutschlands Zukunft im Kampf gegen den Bolschewismus gefallen ist, ein kleiner Trost sein“, schrieb Pinzgers Kompaniechef an dessen Eltern: „Auch sein Opfer und sein Blut werden beitragen zu einem grossen, deutschen Sieg.“
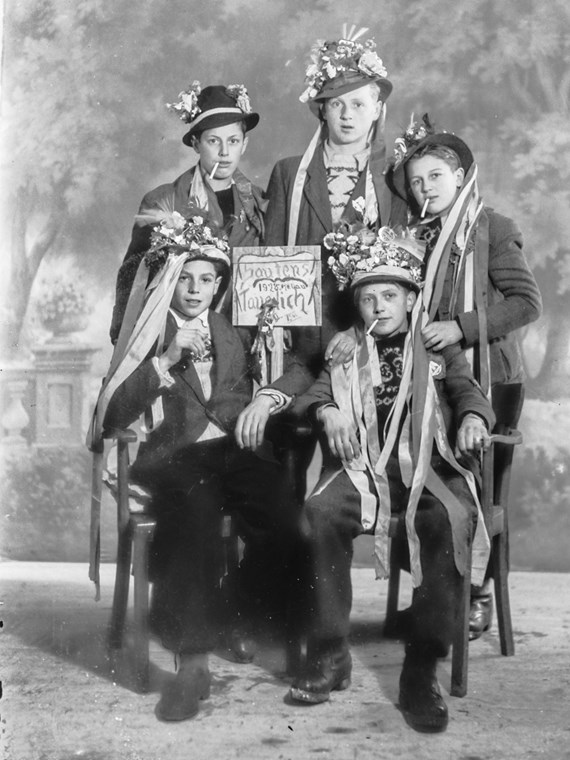
Vom Sinn des Leidens
Die nur noch zwei bis vier Seiten dünne Parteizeitung der Innsbrucker Nachrichten beschwor täglich die Leidensfähigkeit der Bevölkerung mit Durchhalteparolen und pseudophilosophischen Betrachtungen über die Bejahung des Leides. Josef Wörle, der Pfarrer von Wängle im Außerfern, machte sich auch Gedanken über den Umgang mit dem unermesslichen Leid. Sein Rat: Man dürfe sich nicht von schwermütigen Stimmungen beherrschen lassen, seine Arbeiten und Pflichten müsse man weiter verrichten. Es gelte, alles Unangenehme auf sich zu nehmen und auf ein offenes Ohr bei Gott zu hoffen. Die Mutter von Stefan Lami aus Silz handelte ganz in diesem Sinne. Sie besuchte ihren schwer verwundeten Sohn im Lazarett in Innsbruck, zeigte sich jedoch seltsam unberührt, geradezu stoisch, nicht nur gegenüber ihrem verletzten Sohn. Auch als sie die Nachricht vom Tod ihres anderen Buben erfuhr, blieb die tiefgläubige Frau gefasst: „Der Herrgott wird schon wissen, warum.“ Letztendlich forderten Nationalsozialismus und Kirche Ähnliches von den Menschen: Im Sinnlosen Sinn zu finden, das Opfer zu akzeptieren, das Hakenkreuz oder Christenkreuz zu tragen. Die Nazis hatten den Trauernden nur Großdeutschland anzubieten, ein Gebilde, das sich gerade in Nichts auflöste, die Kirche aber das Himmelreich und eine lange Tradition tröstlicher Rituale. Im Mai 1945 waren die Kirchen überfüllt, die Prozessionen im Juli wahre Triumphzüge. Tausende dankten Gott und der Jungfrau Maria für die Rettung in höchster Not. Als die Gemeinde Schwoich 1946 ein neues Kriegerdenkmal errichtete, entschied sich die Mehrheit bei einer Dorfbefragung für den Text: „Dies ist unsere Botschaft. Erhaltet den Frieden, kein Opfer sei zu groß, um ihn zu bewahren.“ Der zweite Vorschlag blieb in der Minderheit: „Dies ist unser Wort: Seid menschlich! Sagt nie wieder Jawohl!“
Innsbruck wurde während des Zweiten Weltkriegs von 22 Luftangriffen schwer getroffen worden. Etwa 500 Menschen starben dabei. Die von der NS-Propaganda beschworene „Alpenfestung“ war nur ein Mythos.
Im Rahmen der „Operation Greenup“ wurden Agenten eingeschleust, die mit den gefunkten Informationen zu einem rascheren Ende des Krieges in Innsbruck beitrugen.
In den letzten Kriegsmonaten hatte sich in Innsbruck eine Widerstandsbewegung gebildet, die aber militärisch eher unbedeutend war. Die letzten Kriegstage verliefen unruhig, wirr und von widersprüchlichen Nachrichten durchsetzt, während sich die militärischen und politischen Einrichtungen der Nationalsozialisten Zug um Zug auflösten. In einer Rundfunkansprache am 1. Mai 1945 kündigte Gauleiter Franz Hofer den Verzicht auf die militärische Verteidigung Innsbrucks an. Am 2. Mai besetzten Mitglieder der Widerstandsbewegung die Inn-Kaserne und andere militärische Einrichtungen, die sie aber bald wieder räumen mussten. Erst am folgenden Tag, als sich die letzten militärischen Einheiten zurückgezogen hatten, übernahm die Widerstandsbewegung endgültig die Befehlsgewalt in der Stadt.
Am 3. Mai 1945 wurde die Stadt von den Widerstandskämpfern den Amerikanern kampflos übergeben. Um 19 Uhr 45 rückte das 1st US-Battalion der 103. Infanterie-Division in Innsbruck ein. Damit war das Ende der NS-Herrschaft in Innsbruck besiegelt, der Krieg endgültig vorbei. .
In Europa endete der Zweite Weltkrieg am 8. Mai 1945.

